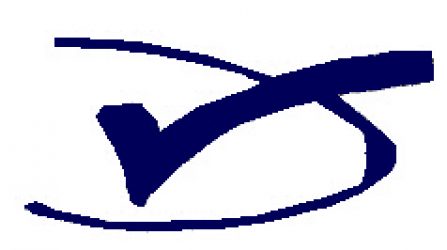„Weit in der Champagne / im Mittsommergrün, dort, wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blüh’n / da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, / der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt / und du warst nicht einmal neunzehn Jahre alt.“ (Lied „Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader, 1982)
Predigt Gottesdienst
zu Erinnerung an den Ersten Weltkrieg (Prediger 8,6-9), 2014
Wer einmal einen Soldatenfriedhof besucht hat, der weiß um die Grabkreuze, die dort stehen: oft hunderte in einer Reihe, wenn man über sie hinweg sieht, verschwimmen sie: So unendlich viele! Und oft stehen keine Namen dabei, so wie Hannes Wader singt (1982). Und es ist unbegreiflich, wer und wie viele dort liegen, und wie die Zeit war, 1914, als dieser Krieg losbracht. Welch ein Abstand: Hundert Jahre sind lang.
Die Lieder und Songs aus der Friedensbewegung der 1980er Jahre haben das versucht. Sie haben die Erinnerung an den Krieg benutzt, um Gefühle dafür zu wecken, was Krieg bedeutet und welche Folgen er hat. Sie sangen von Wind und Blumen.
Die Lieder haben eine eigentümliche Fremde: Neulich bei der Eröffnung der Friedensausstellung im Burggymnasium erklangen sie – und nur die ältere Generation konnte einstimmen:
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? – Mädchen pflücken sie geschwind … Wo sind all die Mädchen hin, Männer nahmen sie geschwind … Wo sind all die Männer hin? Zogen fort, der Krieg beginnt …
Tatsächlich, in dieser Reihenfolge kam es. Ein deutsches Mädchen schreibt am 4. August 2014 in ihr Tagebuch:
„So kamen sie Schulter an Schulter und überfluteten den Bahnsteig wie eine graue Welle. Alle Soldaten trugen um Hals und Brust lange Gewinde aus Sommerblumen. Selbst in den Gewehrläufen steckten Sträuße von Astern, Levkojen und Rosen, als wollten sie den Feind mit Blumen beschießen.“
Es ist Sommer, es ist Anfang August, als sie losgehen. Die Gärten sind voller Blumen. Aber es geht nicht sehr lange um Wind und Blumen in diesem Krieg. Sie werden den Feind nicht mit Blumen beschießen, sondern mit Schrapnellen und Mörsern, mit Maschinengewehren und Giftgas. Kein Wind und keine Blumen mehr, sondern kalter Regen und vollgelaufene Schützengräben, Baumgerippe und wegloser Morast auf den Schlachtfeldern.
Nur ein Bruchteil der Hunderttausenden von Toten der großen Schlachten wird später überhaupt in Reihen und mit Kreuzen und in Gräbern bestattet werden können, auf denen Blumen wachsen können und über die der Wind geht. Als sie losgehen, mit Astern und Levkojen am Gewehr, von den Feldern, auf denen sie gearbeitet haben auf das Feld der Ehre, wissen sie nichts davon.
Das biblische Buch des Prediger Salomos weiß um die Bösheit, zu der der Mensch fähig ist, und über die Gefahr, die Folgen seines Handelns nicht überblicken zu können oder zu wollen, und über die Blindheit, es nicht wahrhaben zu wollen: Wir lesen wir im 8. Kapitel:
Denn jedes Vorhaben hat seine Zeit und sein Gericht, und des Menschen Bosheit liegt schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was geschehen wird, und wer will ihm sagen, wie es werden wird?
Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und hat keine Macht über den Tag des Todes, und keiner bleibt verschont im Krieg, und das gottlose Treiben rettet den Gottlosen nicht.
Das alles hab ich gesehen und richtete mein Herz auf alles Tun, das unter der Sonne geschieht zur Zeit, da ein Mensch herrscht über den andern zu seinem Unglück. (Prediger 8,6-9)
Das sind biblische Worte, so zeitlos wie Wind und Blumen sind. Diese Worte dehnen sich über die Zeit. Sie bleiben so beweglich und lebendig wie der Wind. Sie sind immer frisch und neu, wie die Blumen. In diesen Worten verdichtet sich eine menschliche Erfahrung: Dass nichts bleibt, wie es war. Dass nichts so ist, wie es anfangs erscheint. Und einmal auch die andere Seite zu sehen sein wird. Jedes Vorhaben hat seine Zeit und sein Gericht.
Das Buch des Predigers ist ein Buch voller Skepsis. Wir kennen andere Worte aus diesem Zusammenhang, dass zum einen immer das andere gehört. Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit, Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit und Friede hat seine Zeit und so weiter und so weiter…
Der Mensch weiß nicht, was geschehen wird.
Als die Soldaten loszogen, mit Blumen am Gewehr im August 1914, dachten alle: Jetzt ist es endlich so weit. Die bürgerlichen Schichten begrüßten die Mobilmachung, weil sie an die besondere Sendung des deutschen Volkes glaubten. Sie wurden darin unterstützt und befeuert von Predigern, die davon sprachen, dass dieser Krieg heilig sei und sogar ein Gottesdienst. Kaiser Wilhelm II ruft den Deutschen zu: „Vorwärts mit Gott, der mit uns sei wird, wie er mit den Väter war!“
Ob nicht einige doch gewusst haben, dass die Blumen in ihren Gewehren sehr bald schon verwelkt sein würden und dass sie bestimmt nicht Weihnachten wieder zu Hause sein würden?
„Die Gesichter der Soldaten waren ernst. Ich hatte gedacht, sie würden lachen und jubeln“, schreibt das Mädchen ins Tagebuch. Sie blicken ernst und sie wussten im Sommer 1914 nicht, dass der Krieg, in den sie zogen, zum Inbegriff werden würde für das, was Krieg bedeutet. Dass er die Weisheit des Predigers bestätigen würde, dass keiner verschont bleibt im Krieg.
Krieg kommt nicht wie eine Naturkatastrophe über die Menschen. Der Text fragt bewusst nach der Bosheit des Menschen und seiner Schuld. Auch der Erste Weltkrieg ist nicht ausgebrochen, sondern er wurde begonnen:
Am 28. Juli erklärt Österreich-Ungarn den Serben den Krieg. Deutschland erklärt am 1. August Russland den Krieg. Am 3. August Frankreich. Am 4. August erklärt England Deutschland den Krieg, um am 5. August Belgien Deutschland und Österreich-Ungarn den Russen. Innerhalb von einer Woche befindet sich Europa im Krieg, innerhalb von vier Wochen die Welt.
Sag, wo die Soldaten sind? Wo sind sie geblieben? Über Gräbern weht der Welt. – Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen weh’n im Sommerwind … So dreht sich die Sache im Lied „Where have all the flowers gone“ im Kreis!
Am Ende bleiben dann also Wind und Blumen?
Es bleibt die Skepsis des Predigers Salomo, der so viel gesammelt hat an menschlicher Erfahrung: Er zweifelt selbst an dem, was er bereits verstanden zu haben glaubte. Er stellt wieder in Frage, was schon längst zu einer Einsicht geworden war, zur damaligen Zeit und auch heute!
Diese Skepsis darf sich nie legen, wie der Wind sich nicht legt. Sie muss nachwachsen, wie die Blumen nachwachsen.
Doch wann werden wir verstehen?
Sind wir skeptisch genug?
Bringen wir die ausreichend kritische Haltung ein, wenn zu unserer Zeit nach militärischem Eingreifen gerufen wird? Fürwahr, die Entscheidungen sind einfacher geworden, aber werden sie sich oft nicht zu einfach gemacht?
Konfliktforscher warnen vor Militäreinsätzen etwa in Afrika: Es ist sei einfach zu sagen, wir schicken mal das Militär – was soll es ausrichten, wenn nicht die politischen und wirtschaftlichen Ursache für Konflikte bearbeitet werden?
Sind wir skeptisch genug, wenn auch für unser Land nach neuer militärischer Stärke gerufen wird, sei es durch Bundespräsident, Verteidigungsministerin oder Außenminister? Die Präsidentin von Brot für Welt sieht in mehr Militäreinsätzen eine Gefahr für zivile Helfer, die zwischen die Fronten kommen und nicht mehr als neutral betrachtet werden.
Sind wir skeptisch genug, aus dem Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zu lernen? „Nichts ist gut in Afghanistan“, spitze einst die ehemalige Bischöfin Margot Kässmann zu und bezog viel Kritik. Dabei mahnte sie nur die vorrangige Option für die Gewaltfreiheit und die zivile Hilfe an – unsere kirchliche Haltung, die wieder neu und lauter gesagt werden sollte.
Auf unseren Soldatenfriedhöfen blühen die Blumen und das Gras geht im Wind. Die Soldatentafeln in unserer Lutherkirche muten fremd und aus einer anderen Zeit an. Sind sie ja auch. Mit dem Abstand eines Jahrhunderts ist es leicht, die Übersicht zu bekommen über das, was damals geschehen ist. Wir können gut urteilen. Wir sind uns einig darin, dass der Krieg damals schrecklich und sinnlos war. Mit Blumen und Hurra werden keine Soldaten in Deutschland mehr verabschiedet, Gott sei Dank.
Die Frage ist aber: Sehen wir heute weiter? Können wir die Folgen eines militärischen Eingreifens absehen?
Sind wir selbstkritisch und skeptisch genug, wenn wir heute vor die Frage gestellt werden?
Die Predigt soll mit diesen offenen Fragen enden. Denn wenn mich die Soldatenfriedhöfe, das Gedenken an 100 Jahre Friedensbewegung, die alten Friedenslieder eines lehren, dann dies: Müssten wir nicht wieder skeptischer werden im Wissen, das der Mensch nie abmessen kann, was sein Handeln für Folgen hat? Dass er verführbar ist für alle mögliche Ideologie, auch heute? Und vielleicht auch dies: dass womöglich nur der Frieden und die Vergebungsbereitschaft herausführt aus der Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Was anderes sollte helfen in diesen Tagen in Israel und Palästina?
So wünsche ich mir – mit aller Symbolkraft, die damit verbunden wäre -, dass die jungen Menschen von den Alten wieder die alten Friedenslieder lernen. Nicht um eines lebensfernen radikalen Pazifismus wegen, der kann mitunter auch verantwortungslos sein. Sondern um das kritische Fragen und die Skepsis wieder zu lernen und die Augen vor den Folgen von Krieg nicht zu verschließen, den wir, Gott sei Dank, im eigenen Lande seit Generationen nicht mehr kennen: Where have all the flowers gone – sag mir, wo die Blumen sind! Und welche Geschichten sind darunter begraben, in den Gräbern, sei es unter den Gräbern vor 100 Jahren oder von heute?!