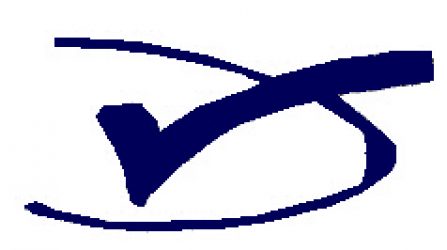„Wie schön das wär’: Nur einen Himmel gäbe es und keine Hölle“, seufzt das Mädchen. Der Vater sitzt am seinem Bett und hört zu. In den Tagen zuvor ist der Irakkrieg ausgebrochen. In das Dunkel des Abends seufzt es.
Zwischen Himmel und Erde
Predigt zur Ordination zu Jesaja 63,15-19b – 8.12.2004/Kirche Villigst)
„Wie schön das wär’: Nur einen Himmel gäbe es und keine Hölle, / keine Religion, die sich für die einzig wahre hält,
alle Menschen wären gleich, egal welcher Hautfarbe.
[Wie schön das wär, wie schön, wie schön das wär’]
Wie schön, wie schön, wie wunderschön das wär.
Keiner müsste mehr hungern, keiner würde mehr gequält,
keiner wäre geizig, selbstverständlich würde geteilt.
Es gäbe keine Gründe mehr für Terror, Hass und Neid.
[Wie schön das wär, wie schön, wie schön das wär’]
Wie schön, wie schön, wie wunderschön das wär.“
In diesem Lied von Wolfgang Niedecken träumt ein Mädchen den Himmel, kindlich und konkret. Und ich höre gleichzeitig zwischen den Zeilen, wie ein Mädchen über die Erde klagt.
Hoffnung und Klage: Mich fasziniert, wie sich in den Träumen des Mädchen Himmel und Erde berühren.
Wenn sich das Mädchen wünscht, dass die Menschen teilen, hat es erfahren, wie habgierig und egoistisch Menschen sein können. Und wenn es am Sinn der Religion zweifelt, ahnt es, wie die Fürsten dieser Welt – hüben wie drüben – ihre Religion für ihre eigenen Zwecke verraten.
- Dem Vater klagen
Auch im Jesaja-Text berühren sich Himmel und Erde. Auch wenn der Text eine Klage ist. Israel hat damals allen Grund, zu klagen, weil es nach dem Exil vor einem Scherbenhaufen steht: das Staatswesen vernichtet, das Volk zerschunden, der Tempel zerstört. In dieser Lage wendet der Beter seine Augen auf zum Himmel [Ps 121] und ruft nach Gott, er möge sich – verdammt noch mal – wieder blicken lassen:
So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Bist du doch unser Vater; […] Du, HERR, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name.
Die Erfahrung sagt: Himmel und Erde sind zerrissen.
– Gott hat sich entfernt: Er hat sich zurück gezogen auf seinen himmlischen Thron. Auf einen entfernten Zuschauerplatz. Gerade er, der Schöpfer von Himmel und Erde. Er mischt sich nicht mehr ein in das Leben – für das Volk Israel eine unglaubliche Vorstellung:
Der Gott, der sein eigenes Schicksal eng an das seines Volkes gebunden hat, der als Feuersäule durch die Wüste führte und der Manna schickte, als das Volk hungerte – der will von seinem Volk und seinen eigenen Verheißungen nichts mehr wissen? –
Auch heute machen Menschen diese Erfahrung, dass sie Gott gerne beim Wort nähmen – ihn aber nicht finden. Es gibt Gebete, die unerhört bleiben, und Bitten, auf die Gott nicht antwortet.
Die Erfahrung sagt: Himmel und Erde sind zerrissen.
– Der Mensch hat sich entfernt: Er fürchtet Gott nicht mehr. Er kennt Gott nicht mehr. – Heute müssen wir noch drastischer sagen: Viele Menschen haben nicht nur Gott vergessen, sondern: Sie haben auch vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Es spielt für sie gar keine Rolle mehr, ob sich Gott unserem Leben entzieht oder für uns da ist. Es lässt sich auch ganz gut ohne Gott ganz gut leben.
Wir be-klagen alles Mögliche, auch in der Kirche: Dass das Geld nicht mehr reicht, Gebäude geschlossen und Mitarbeitende entlassen werden müssen. Ihm dies alles zu klagen – das höre ich in unseren Gottesdienste selten.
Und doch glaube ich: Auch in dieser alte Klage bei Jesaja berühren sich Himmel und Erde.
Denn die Klagenden ersticken nicht in Mutlosigkeit und ergeben sich nicht achselzuckend in ihr Schicksal: Et kütt halt wie’s kütt.
Hier reden die Kinder Gottes mit ihrem Vater: Du bist doch unser Vater! Du, Schöpfer, hast uns doch in und auf die Welt gesetzt. Komm da oben runter! Setz dich zu uns! Komm an die Orte unserer Sorgen und Nöte und hör uns zu!
Für damalige Ohren geradezu Gotteslästerung: Gott als Papa – als Abba, wie Jesus ihn dann nennen sollte – gibt es nur zweimal im Ersten Testament. Zu nah, zu innig dieser Gottesname.
Und gerade auf diesen Namen wird Gott verhaftet: Auf die väterliche Fürsorgepflicht, auf die mütterliche Barmherzigkeit. Gott wird erinnert an seine eigene Verheißung am Dornbusch, wo er Mose seinen Namen sagt: Ich bin für dich da.
Wer so den Vater ruft, der setzt doch seine Hilfe auf Gott. Diese Klage rechnet mit Gott. Mitten in die Gottesferne hinein, hofft das Volk: Er küt, Gott kommt. Kein schicksalhaftes „Et kütt halt wie’s kütt“. Sondern: Er küt. Er kommt vom himmlischen Thron herunter auf die Erde. Quasi an unsere Bettkante.
III. Einen neuen Himmel und eine neue Erde träumen
Wie antwortet der Vater auf die Klage – ich meine den Vater am Bett seiner Tochter? – In dem Lied weicht er aus. Er ist überfragt.
Und wir? Wenn Dein Kind Dich morgen fragt? (Dtn 6,20)
Als Christinnen und Christen – allzumal im Dienst der Wortverkündigung – kommen wir um eine Antwort nicht herum: eine Antwort auf die Sorgen und Klagen der Menschen, und eine Antwort auf ihre Träume.
Wenn Dein Kind Dich morgen fragt … – was antwortest Du?!
Was sind Deine Visionen auf die Fragen:
- Wie können wir glauben? –
Gott scheint oft fern.
- Wie wollen wir leben? –
Zahllose Lebensentwürfe sind möglich.
- Wie sollen wir handeln? –
Alles hängt heute global zusammen und macht uns zunehmend hilflos und handlungsunfähig.
Wenn Dein Kind Dich morgen fragt … Ich vertraue darauf, dass Gott für mich da ist. Dass sich eben nicht Himmel und Erde trennen lassen in einen Himmel als Wohnung Gottes und eine Erde als Autonomiegebiet der Menschen.
Freilich gibt es Grund zur Klage: In meiner Klage möchte ich mit Gottes (Entgegen-)Kommen rechnen. So bleibt die Klage nicht der Welt verhaftet.
Freilich gibt es auch Hoffnung – wie die Menschen in der Ukraine uns gezeigt haben, als sie für Demokratie wochenlang auf den kalten Plätzen ausgeharrt haben. Auch in meinen Hoffnungen möchte ich mit Gottes (Entgegen-)Kommen rechnen – damit die Hoffnungen nicht weltflüchtig werden, sondern ganz konkret mit dieser Welt zu tun haben.
Wie die Träume des Mädchens.
Wie die großen Hoffnungssätze vom „neuen Himmel und der neuen Erde“ (Jes 65), wie sie wenig später im Jesaja-Buch folgen:
Kein Kind muss früh sterben.
Heimatlose bauen Häuser.
Es gibt gute Arbeit.
Solche Visionen protestieren gegen die Welt, wie sie ist; aber sie schweifen nicht in die Ferne. Sie gehen über uns hinaus, aber wollen uns hier zum Handeln befreien.
Nehmen wir die Hoffnungen dieses Mädchens: Alle Menschen sind gleich. Sie teilen. Sie foltern nicht. Diese Hoffnungssätze sind doch durch und durch „Leidenschaft fürs Mögliche“ (Kierkegaard). Sie machen mit den Möglichkeiten ernst, die unsere Welt durchziehen:
Wer sagt, es wird nie Frieden sein – der muss mir erklären, ob Krieg quasi ein Naturzustand ist, den es immer geben wird. Wer sagt, es wird nie Gerechtigkeit geben – der muss mir erklären, warum wir nicht wenigstens mehr Gerechtigkeit wagen. Und wer sagt, es kommt zwangsläufig zum Kampf der Kulturen, der muss mir erklären, warum meine Vision vom friedlichen Miteinander weniger realistisch sein soll. Drehen wir die Beweislast um: Nicht wer Frieden und Gerechtigkeit versucht, soll sich erklären müssen, sondern wer Krieg und Unrecht übt.
- Da berühren sich Himmel und Erde
Nicht zufällig warten wir im Advent darauf, dass ein Kind zur Welt kommt und zur Hoffnung der Welt wird. Mitten in der noch nicht erlösten Welt naht unsere Erlösung [Wochenspruch: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sie eure Erlösung naht, Mk 21,28b]. Bis es am Ende der Zeit zum „neuen Himmel und zur neuen Erde“ kommt, verspricht uns Gott, der nahe Gott: Schon jetzt berühren sich Himmel und Erde.
Wie schön, wie schön, wie wunderschön das ist! – Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.